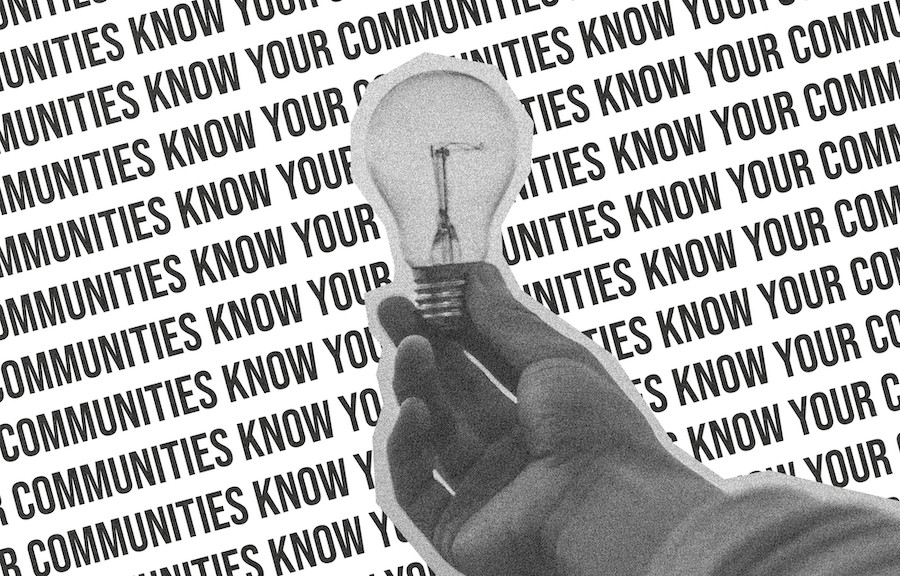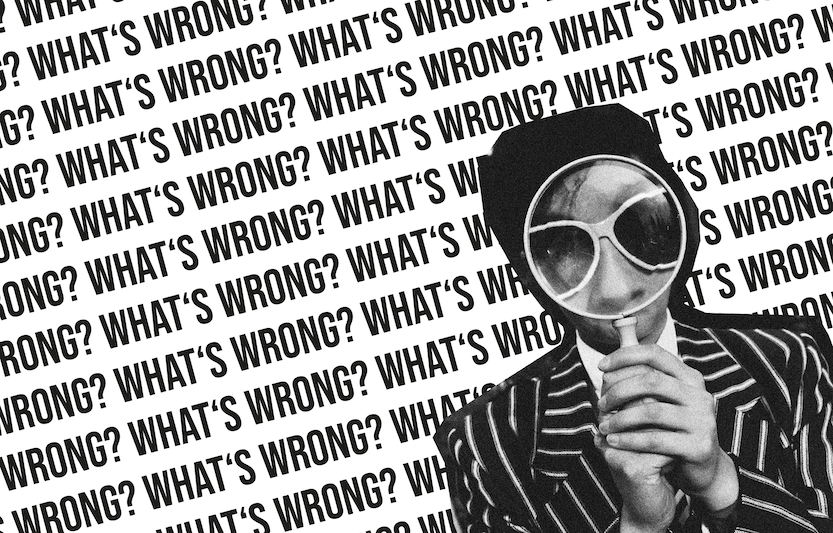Marken stehen heute vor einem Paradigmenwechsel, sowohl im Konsumenten- wie im Arbeitgebermarkt. Die klassische Ausrichtung auf breite, demografisch definierte Zielgruppen ist nicht zukunftsgerichtet und verspricht nur wenig Erfolg, denn: Wer heute eine Marke erfolgreich positionieren will, muss mehr tun, als Produkte verkaufen: Es geht darum, Identität und Zugehörigkeit zu schaffen.
Der Wandel des Zielgruppenverständnisses
Kennt ihr schon die „Wir sind für alle da“-Falle? Viele Unternehmen behaupten: «Unsere Produkte sind für alle da.» Klingt logisch, ist strategisch aber gefährlich. Wer versucht, für alle relevant zu sein, läuft Gefahr, gleichzeitig für niemanden richtig relevant zu sein. Als Folge wird man austauschbar, zeigt keine Haltung und keinen klaren Markenkern. Was dabei absolut entscheidend ist: Potenzielle Kund:innen eines Produktes machen nicht automatisch die gesamte Zielgruppe aus, die eine Marke mit ihrer Positionierung erreichen will.
Starke Marken treffen nämlich bewusst Entscheidungen. Sie wissen, für wen sie stehen – und für wen nicht. Das erfordert Mut zur Abgrenzung und eine klare Positionierung entlang der eigenen Werte. Nur so entsteht echte Differenzierung in überfüllten Märkten
Wertegruppen als neue Relevanz im Markenbuilding
Wir sind der Meinung: Die Zukunft gehört Marken, die Wertegruppen verstehen – also Menschen, die ähnliche Überzeugungen, Haltungen und Lebensstile teilen. Hier geht es nicht mehr um reine demografische Daten, sondern um psychografische Merkmale: Motive, Einstellungen und Werte.
Kund:innen sind heute informierter, vernetzter und anspruchsvoller als je zuvor. Sie erwarten nicht einfach Produkte, sondern Erlebnisse, die zu ihrem Lebensstil passen. Genau hier kommt psychografische Segmentierung ins Spiel: Statt auf starre Personas oder oberflächliche Statistiken zu setzen, geht es darum, Motive und Lebensstile zu verstehen.
Identität stiften statt Kaufverhalten analysieren
Wer eine Marke über Werte führt, baut eine emotionale Beziehung auf, die weit über die Kaufentscheidung hinausgeht. Kund:innen fühlen sich verstanden, weil sie ihre Überzeugungen in der Marke wiederfinden. Das Gleiche gilt intern: Wenn Mitarbeitende die Unternehmenswerte leben, wird die Marke glaubwürdig – nach innen und aussen. So entsteht keine transaktionale, sondern eine relationale Verbindung, die die Basis für echte Loyalität schafft.
Relevanz entsteht in der Community, nicht in der Zielgruppe
Marken, die heute relevant bleiben wollen, müssen ihre Denkweise verändern: Weg von klassischen Zielgruppen, hin zu Wertegruppen und Communities. Folgende Merkmale unterscheiden dabei die zwei Konstrukte:
- Fokus: Während sich klassische Zielgruppen auf die Frage „Wer kauft das Produkt?“ und damit auf Alter, Einkommen und Geografie fokussieren, fragt man sich bei Communities: „Warum kauft die Person das Produkt?“ Damit richtet man den Fokus stärker auf Werte, Überzeugungen und Zugehörigkeit.
- Ziel: Klassische Zielgruppen verfolgen primär ein effizientes Targeting und eine Minimierung von Streuverlusten, während Communities Identität stiften und eine emotionale Bindung stärken.
- Datenbasis: Insights zu klassischen Zielgruppen bestehen normalerweise durch statistische Panels und demografische Studien. Communities lassen sich hingegen mit qualitativer Forschung, Social Listening und Wertestudien erfassen.
Fazit: Was Unternehmen tun müssen
- Macht einen Haltungs-Check: Sind primäre und sekundäre Zielgruppen klar definiert – und ist auch festgelegt, wer bewusst nicht adressiert wird? Nur so werden Ressourcen gezielt eingesetzt und der Markenkern geschärft.
- Spielt einen Marken-Audit durch: Spiegelt die Marke wirklich das wider, wofür sie steht? Prüft, welche Wertegruppen ihr bereits bedient – und wo ihr Zugehörigkeit aktiv fördern könnt. Am besten geht das mit qualitativen Fokusinterviews.
- Achtet in der Ausspielung auf das richtige Zusammenspiel zwischen Awareness und Tiefe: Awareness-Kampagnen sorgen für Sichtbarkeit, echte Community-Arbeit für Bindung. Entscheidend ist dabei, Inhalte nicht einfach zu übersetzen, sondern zu lokalisieren – also Tonalität und Kontext an die jeweilige Community anzupassen.